Die USA gelten als Vorzeigeland für Investigative Recherche. US-amerikanische Journalisten verstehen sich als Kontrolleure der Politik, nicht nur als reine Informationsvermittler. Gestützt wird der investigative Journalismus in den USA durch die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Der wichtigste Punkt: Investigativer Journalismus wird als Qualitätsprodukt vermarktet.
Die Rechtslage
Das Selbstverständnis der Journalisten als „watchdogs“, also Wachhunde der Gesellschaft, hatte in den USA viel Zeit, um sich auszubilden. Die Pressefreiheit ist bereits in der US-amerikanischen Verfassung aus dem Jahr 1787 im First Amendment, dem ersten Zusatzartikel von 1791, verankert: Sie bildet seither die Grundlage für journalistisches Arbeiten in den Vereinigten Staaten. Der Supreme Court, der oberste Gerichthof des Landes, hat der Presse außerdem wiederholt und eindeutig eine „checking value“ zugesprochen, also die Aufgabe zu kontrollieren oder überwachen.
Das wichtigste Gesetz für den redaktionellen Alltag bildet der Freedom Of Information Act (FOIA) von 1967, demzufolge die Bundesbehörden der USA einer grundsätzlichen Auskunftspflicht unterliegen, die nicht nur Journalisten gegenüber gilt. Es besagt, dass die Behörden jedem Bürger auf schriftlichen Antrag hin ihre Unterlagen zugänglich machen müssen. Die US-amerikanischen Behörden können sich jedoch auf einen von neun Geheimhaltungsgründen (wie beispielsweise Gefahr für die nationale Sicherheit) berufen.
Zwar kann das Antragsverfahren ähnlich wie in Deutschland sehr lange dauern, aber in den USA sind weitaus mehr investigative Rechercheerfolge auf Anträge nach dem FOIA zurückzuführen als das in Deutschland mit dem Informationsfreiheitsgesetz der Fall ist. Die US-amerikanische Regierung ermutigt auf ihrer Internetseite geradezu dazu, einen Antrag nach FOIA zu stellen: An prominenter Stelle findet sich dort eine ausführliche Anleitung und eine Liste mit möglichen Ansprechpartnern – Zustände, von denen deutsche Journalisten nur träumen können.
In einer rechtlich schwächeren Position befinden sich US-amerikanische Journalisten allerdings beim Informantenschutz. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Fälle wie der von New York Times-Reporterin Judith Miller bekannt, die 85 Tage im Gefängnis verbrachte, weil sie den Namen eines Informanten nicht preisgeben wollte. Das Gesetz sichert US-amerikanischen Journalisten kein absolutes Zeugnisverweigerungsrecht zu: Es findet im Einzelfall eine Güterabwägung statt, bei der es vor allem entscheidend ist, ob die Informationen, die sich das Gericht von der Bekanntgabe der Quelle verspricht, relevant sind für die Aufklärung einer schweren Straftat.
Der Informant selbst wird allerdings durch den Whistleblower Protection Act geschützt: Regierungsmitarbeiter, die eine Information preisgeben, dürfen deswegen nicht entlassen oder anderweitig bestraft werden. Das entspricht der allgemeinen Kultur in den USA, wo Informanten überwiegend positiv gesehen werden. In Deutschland werden Menschen, die vertrauliche Informationen weitergeben, oftmals als Nestbeschmutzer beschimpft – auch wenn der Geheimnisverat geschieht, um einen Skandal aufzudecken, der für die Gesellschaft höchst relevant ist.
Die US-amerikanischen Open Meeting oder auch Sunshine Laws, die sowohl für einzelnde Bundesstaaten als auch für das ganze Land gelten, halten außerdem fest, dass alle Treffen und Besprechungen öffentlicher Körperschaften öffentlich sein müssen. Das erleichtert oft die Informationsbeschaffung ebenso wie der im Allgemeinen laschere Datenschutz. Letzteres erleichtert insbesondere das Computer Assissted Reporting (CAR), bei dem systematisch Datenbanken nach bestimmten Informationen gescannt werden.
Außerdem ist es in den USA eher schwierig, Beleidigungsklagen gegen Journalisten zu gewinnen. Trotzdem sind Drohungen von Betroffenen oft wirkungsvoll – insbesondere bei kleineren Verlagen, da im Erfolgsfall Millionenbeträge fällig werden. Die relativ guten rechtlichen Voraussetzungen werden in diesem Punkt von ökonomischen Zwängen überschattet.
Der ökonomische Rahmen
In den USA gilt wie überall: Investigativer Journalismus ist teuer. Erstens muss man in Kauf nehmen, dass komplexe und langwierige Recherchen unter Umständen ins Leere laufen. Und zweitens können selbst im Erfolgsfall aufwändige Klagen drohen.
Die wirtschaftlichen Bedingungen für investigativen Journalismus verschlechtern sich in den USA kontinuierlich. Schuld daran ist vor allem die starke Konzentration auf dem US-Medienmarkt, die sich laufend verstärkt: Einige wenige Megakonzerne beherrschen den Markt (Time Warner, The Walt Disney Company, News Corporation, Viacom und Bertelsmann). Durch die kartellartigen Strukturen wird die Medienvielfalt eingeschränkt. Auf dem Zeitungsmarkt beispielsweise haben 99,9 Prozent der Publikationen eine Monopolstellung. Solche Entwicklungen schränken den Wettbewerb ein, der für investigativen Journalismus auf dem US-Medienmarkt dringend erforderlich ist.
Aber Investigativer Journalismus ist für US-Zeitungen noch immer ein wichtiger Imagefaktor. Exklusivberichte werden von den US-Lesern durchaus wahrgenommen und verschaffen der Zeitung Renomee und damit eine Auflagensteigerung. Ebenso werden gewonnene Journalistenpreise auf aufwändigen Anzeigen im eigenen Blatt beworben. Sie spielen seit jeher eine wichtige Rolle in der Medienkultur der USA; bereits seit 1985 gibt es auch eine investigative Kategorie des renommierten Pulitzer Prices.
Verlage und Medienunternehmen streben danach, so viele Preise wie möglich zu gewinnen, um sich Renommee zu verschaffen und die Auflage zu steigern. Und wie gewinnt man Preise? – Durch investigativen Journalismus.
Fazit
US-Journalisten können im Vergleich mit deutschen Kollegen von zwei entscheidenenden Faktoren in der Medienlanschaft ihres Landes profitieren: Erstens haben sie mit dem Freedom of Information Act ein wesentlich besseres Werkzeug in der Hand als die Deutschen mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Und zweitens – was vielleicht noch entscheidender ist – wird investigativer Journalismus als Qualitätsprodukt wahrgenommen und vor allem auch als solches vermarktet.

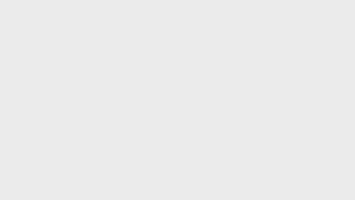
Kommentar hinterlassen