Auch in den USA stecken die Zeitungen tief in der Krise. In den Redaktionen wird radikal gespart – darunter leidet die Qualität der Recherche. Der blinde Fleck sprach mit Gerard Colby, dem Präsidenten der „National Writers Union“*, über die Probleme investigativer Journalisten.
Haben sich die Bedingungen für investigatives Arbeiten mit der Finanzkrise verändert?
Man muss leider ganz klar sagen, dass investigativer Journalismus seit der Finanzkrise auch in den USA keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Schon vor der Finanzkrise gab es den Trend weniger in investigativen Journalismus zu investieren. Das hing mit dem Verlust an Lesern an das Internet zusammen. Mit der Finanzkrise gab es dann viele Entlassungen von Journalisten im ganzen Land.
Die Krise hat also eine schon vorhandene Entwicklung beschleunigt?
Ja, sie wurde als Anlass genutzt, die Medien so neu zu strukturieren, wie es schon vorher geplant war, um im digitalen Zeitalter den meisten Profit aus ihnen herauszuholen.
Was bedeutet das konkret für die Arbeitssituation der Journalisten?
Freie Journalisten, inklusive der, die ihre vormalige Festanstellung verloren haben, sind mit neuen Verträgen konfrontiert. Diese beschränken ihre Zweitverwertungsrechte. Sie dürfen einen Beitrag nicht in verschiedenen Staaten, Sprachen oder Formaten mehrfach veröffentlichen. Dadurch haben freie Journalisten sich früher ihren Lebensunterhalt gesichert. Unter den verschärften Bedingungen müssen sie sich nun neu organisieren.
Wird es trotzdem in Zukunft noch investigativen Journalismus in den USA geben?
Zwar gibt es bei den großen Medien immer noch Teams von investigativen Journalisten, aber es werden immer weniger. Allgemein haben sich die Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass es in Journalistenkreisen ernsthafte Diskussionen gab, ob der investigative Journalismus in den USA überhaupt überleben wird.
*Die National Writers Union ist eine Gewerkschaft von freischaffenden Schriftstellern und Journalisten.

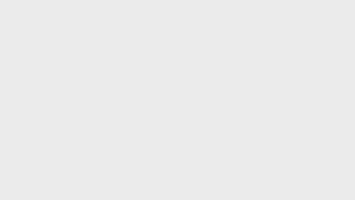
Kommentar hinterlassen