Kommunikationswissenschaftler Armin Scholl spricht im Interview mit dem blinden Fleck über die oft ähnliche Sozialisation von Journalisten und über die Folgen für kritischen Recherche-Journalismus.
Was sind ihre Eltern von Beruf?
Armin Scholl: Meine Eltern sind Landwirte und Winzer. Und beide haben kein Abitur.
47 Jahre alt, männlich, studiert: Sie wären der typische Journalist gewesen, kämen ihre Eltern nicht aus der Arbeiterschicht. Gibt es Erklärungen dafür, warum so wenige Journalisten aus dem Arbeitermilieu stammen?
Scholl: Dass Journalisten sich vor allem aus einer mittleren bis gehobenen Schicht rekrutieren, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass diese Schichten bildungsnäher sind. Aus Arbeiterfamilien stammen jedenfalls nicht besonders viele. Die meisten kommen in der Tat aus Beamtenherkünften und Angestelltenfamilien. Wenn man sich den Beruf des Vaters anschaut, dann liegt der Arbeiteranteil unter zehn Prozent.
Früher gab es immer noch vergleichsweise viele Quereinsteiger in den Journalismus. Gibt es so etwas in der heutigen Generation überhaupt noch?
Scholl: Ja, gibt es auch noch. Der Anteil schwindet aber. Wir haben das in zwei Studien 1993 und 2005 überprüft und die Tendenz zur Akademisierung ist noch höher geworden. Das heißt, es wird immer schwieriger, mit einem nicht-akademischen Abschluss als Journalist zu arbeiten. Das ist die eine Tendenz. Und die andere ist die, dass es eigentlich auf die Kombination verschiedener Ausbildungsgänge ankommt. Das heißt, es dominiert nach wie vor das Volontariat als betriebsinterne Ausbildung mit gut 60 Prozent, aber es gibt kaum jemanden der nur ein Volontariat gemacht hat. Die haben dann irgendeinen Studienabschluss oder waren zusätzlich an einer Journalistenschule. Auf jeden Fall hat der Berufseinstieg über die Hospitanz, meistens während des Studiums, drastisch zugenommen.
Gibt es irgendwelche Zahlen, wieviele Journalisten eine berufsfremde Ausbilung, vielleicht bei einer Bank, gemacht haben und dann über ein Praktikum auf einmal Journalist geworden sind?
Scholl: Das ist schwer nachvollziehbar. Man kann in der Restkategorie „sonstige Ausbildungsgänge“ mal nachschauen, aber da verbirgt sich relativ viel dahinter. Ich glaube auch, dass nur eine Kaufmanns-Ausbildung nicht reicht. Irgendeine interne Journalismus-Ausbildung muss es geben und sei es auch nur eine schnelle Ausbildung.
Können Sie abschätzen, inwieweit die ähnlichen Bildungsmilieus und Ausbildungsgänge die Berichterstattung der Journalisten beeinflussen?
Scholl: Das muss man glaube ich zweiteilen. Zum einen haben Sie ja die Herkunft der Eltern angesprochen. Das zweite wäre dann der eigene Bildungsweg. Ich denke, je näher es an den Journalisten selbst herankommt, desto wirksamer ist das Bildungsmilieu. Das heißt also: Die Herkunft der Eltern wird mit Sicherheit kompensiert, was das Milieu angeht, wenn der Journalist selber ein Hochschulstudium hatte. Dann spielt die Herkunft der Eltern weniger eine Rolle. Innerhalb der journalistischen Ausbildung – also wenn der Journalist zum Beispiel eine akademische Laufbahn hatte – muss man wieder unterscheiden, worauf sich das in der Berichtererstattung auswirken kann. Also wenn Journalisten im normalen Nachrichtenbetrieb arbeiten, dürfte der Einfluss der eigenen Bildung und des Herkunftsmilieus eine geringere Rolle spielen, als in der nicht-tagesaktuellen Arbeit, etwa in der Hintergrund-Berichterstattung. Der Einfluss ist dort besonders groß, wo die Freiheiten im Journalismus besonders groß sind – dort, wo selbst Themen gestaltet und ausgewählt werden können.
Weil Sie vorhin die eigene Sozialisation angesprochen haben: Es gibt ja oft den Vorwurf, dass Journalisten irgendwann nur noch mit Journalisten rumhängen und dass das dieses Selbstreferenzielle noch fördert. Kann man so etwas feststellen?
Scholl: Ganz deutlich. Wenn man Journalisten mal fragt, was ihre drei wichtigsten Freunde von Beruf sind, dann ist der Anteil an Journalisten unter den Freunden sehr groß. Man ist nicht nur beruflich ständig zusammen, sondern auch noch privat. Und selbst wenn das nicht so ist, dann sind die Redaktion, als Organisation und Arbeitsgemeinschaft dermaßen prägend, dass da schon eine ganze Menge Selbstbezüglichkeit entsteht. Die ganze Debatte, wieviel Einfluss die Herkunft auf den Journalismus hat, stammt von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der selbst an seiner eigenen Person beschrieben hat, wie er in das französische Hochschulmilieu hineingewachsen ist. Und dass er durch die permanente Freundschaft mit anderen wissenschaftlichen Kollegen immer stärker in dieses System reingezogen wurde. Ich denke, das wird im Journalismus ähnlich sein, weil das ja mittlerweile doch ein sehr akademisierter Beruf ist. Auch wenn der Journalismus noch wesentlich stärker von Routine abhängig ist als etwa die Wissenschaft.
Gilt so etwas in stärkerer Form noch für Journalistenschulen? Dort wird man für zwei Jahre zusammengeholt, die Schulen fordern das Netzwerkern gradezu, die Lehrmeister wollen ihre Schützlinge nach oben bringen. Fördert das den Mainstream-Journalismus?
Scholl: Ich denke, das ist ambivalent zu beurteilen. Auf der einen Seite haben Sie sicherlich recht, dass das eine Art Mainstreaming befördert oder zumindest nahelegt. Auf der anderen Seite ist das eigentlich genau das, was man sich mal unter Professionalisierung des Berufes vorgestellt hat. Dass es nicht mehr diesen Wildwuchs gibt und so viel Quereinsteiger, die vielleicht auch keine richtige Ausbildung haben und vielleicht ethische Defizite. Weil sie den Beruf auch vielleicht nicht so gut kennen und wenn überhaupt dann erstmal kennen lernen. Man muss sich dann allerdings fragen, was dieses Mainstreaming bewirkt. Und ob das zum Beispiel zu Defiziten in der Berichterstattung führt.
Wenn darüber hinaus nicht über die eigene Ausbildung und die eigene Berichterstattung reflektiert wird: Sehen Sie dann die Gefahr, dass blinde Flecken entstehen?
Scholl: Ja. Aber selbst wenn es diese Reflexionsinstanzen oder -momente gäbe, dann hört diese gemeinsame Sozialisation der Journalisten ja nie auf. Je länger man in diesem Geschäft drin ist, desto tiefer wird sie. Da kann man noch so viel drüber reflektieren – und es gibt schon so wenig Anlässe dazu, da die meisten Journalisten zu wenig Zeit dazu haben – dann würde das auch nichts nutzen. Aus seiner Haut kommt man auch in der Reflexion nicht richtig raus.
Also ist die Gefahr groß, dass manche Randgruppen oder Themen in den Medien außen vor bleiben?
Scholl: Jetzt ist die Frage: Worauf bezieht sich die Gefahr eigentlich? Das alltägliche Nachrichtengeschäft ist so straff organisiert, dass da Ausbilung oder Herkunft nicht so viel Einfluss haben. Wenn überhaupt ist das eher beim Aufgreifen von neuen Themen der Fall. Dort, wo mehr Hintergrund-Berichterstattung stattfindet. Ich vermute, das Hauptproblem ist nicht die Themenfindung selbst, sondern die Themenbehandlung. Die Art, wie man mit einem Thema umgeht. Wenn man selber jahrelang einen krisensicheren Job hatte – oder zumindest einen Job, in dem man gut verdient hat – dann hat man vermutlich nicht mehr so die Vorstellung davon, wie etwa ein Hartz IV-Empfänger lebt oder leben muss. Die Art ,wie über die Themen geschrieben wird, ist also das Hauptproblem, das daraus resultiert, dass alle Journalisten fast gleiche Sozialisationen haben.
Kann man denn sagen, dass kritische Hintergrund-Reporter eher aus Arbeiterfamilien stammen?
Scholl: Das ist nicht nachzuweisen. Wir können in unseren Umfragen keine Verbindung herstellen zwischen dem Berichterstattungsthema – das würde ja eine Inhaltsanalyse erfordern – und dem Journalisten selber. Macht man eine Inhaltsanalyse, kennt man die Journalisten nicht, macht man eine Befragung, weiß man nicht, worüber sie schreiben. Man müsste eine sehr komplizierte Zusammenschau dieser Methoden machen, um die Fragestellung überhaupt untersuchen zu können. Meines Erachtens ist aber das nicht der Entscheidende Punkt, weil es durchaus auch eine intellektuelle Fähigkeit ist, sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass Akademiker so verbohrt sind, dass sie sich nicht prinzipiell in jemand anders hineinversetzen können. Journalisten sind ja auch – zumindest wenn sie eine solche Ausbildung haben – auch intellektuell verpflichtet, alle gesellschaftlichen Bereiche abzubilden oder zumindest zu berücksichtigen. Das ist meines Erachtens eher eine Frage der intellektuellen Redlichkeit.
Wie steht es mit dem Vorwuf, dass die aus der Mittelschicht stammenden Journalisten sich lieber im Glanz der Politik- oder Wirtschaftelite sonnen wollen, als den Anwalt des kleinen Mannes zu geben, der sie eigentlich sein sollten?
Scholl: Dieser Vorwurf hat mit Sicherheit in Einzelfällen – vielleicht auch vielen Einzelfällen – seine Berechtigung, ist aber auf keinen Fall verallgemeinerbar. Denn dafür ist der Journalismus ein zu vielfältiges Geschäft. Die Journalisten, die das betrifft, die sich also da mit der Elite treffen, um sich mit der Elite zu sonnen, die gibt es mit Sicherheit. Und das sind sicherlich diejenigen, die auch sehr nah an der Elite sind, also etwa der Hauptstadtjournalismus in Berlin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Wirtschaftsjournalismus öfter mal vorkommt. Ein Teil der Finanzkrise ist ja auch deswegen so überraschend gekommen, weil da vielen Journalisten das Gespür gefehlt hat. Weil sie in diesem ganzen – wenn man das so ausdrücken darf – Zirkus mitgemacht haben und dann auch gar nicht mehr die kritischen Stimmen gehört haben, die gewarnt haben, lange vorher, dass es nicht gut gehen kann. Das ist eine Art Besinnungslosigkeit, die durchaus viele Journalisten befällt, die man aber mit Sicherheit nicht verallgemeinern kann. Ich glaube diese Thesen kommen immer daher, dass man an einen bestimmten Teil von Journalisten denkt, wie eben an den Hauptstadtjournalismus, die nah an den Eliten dran sind. Aber man vergisst, dass ein Großteil der Journalisten gar nicht so sehr in dieser Gefahr ist, allenfalls etwa mit der lokalen Elite noch etwas zu tun hat. Und deswegen ist das ein Problem, dass man mit Sicherheit nicht vernachlässigen darf. Man darf es aber auch nicht vorschnell generalisieren und sagen ‚Der Journalismus ist elitehörig‘.
Wenn man den Journalismus als vierte Gewalt im Staat betrachten möchte, wird dann durch diese systembedingte Vorauswahl nicht trotzdem in gewisser Weise Zensur betrieben? Wird dem Ursprungsgedanken, der den Journalismus eigentlich prägen sollte, nicht in gewisser Weise widersprochen?
Scholl: Diese Gegenelite findet tatsächlich abnehmend statt im Journalismus. Unsere Umfragen zeigen zum Beispiel, dass dieser engagierte Journalismus, den man in Richtung vierte Gewalt interpretieren kann, weniger Zustimmung als Rollenverständnis findet. Das hat abgenommen. Aber wenn man Ihre Frage zu Ende denkt und das wieder verknüpft mit der Herkunft der Journalisten, dann würde ich sagen, das ist kein Spezifikum des Journalismus. Dasselbe Problem haben wir etwa auch im Parlament. Auch im Parlament sind bestimmte Berufsgruppen extrem über und andere extrem unterrepräsentiert. Und dann könnte man mit gleichem Grund auch sagen: Auch das Parlament schafft es nicht, die Gesellschaft in irgendeiner Form abzubilden – beziehungsweise bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die es vielleicht grade nötig hätten, in ihrer Gesetzgebung zu berücksichtigen. Wir haben hier quasi parallele Phänomene, die sowohl die Politik betreffen, als auch den Journalismus. Und die vielleicht sogar beide im Zusammenhang auch noch betreffen. Dementsprechend sollte man die kritischen Journalisten, die eher eine Gegenposition zu den Politikern einnehmen, auch fördern. Oder zumindest nicht dafür kritisieren, dass sie kritisch berichten. Der Begriff der vierten Gewalt drückt das leider nicht so gut aus, weil er heute ja mittlerweile despektierlich gemeint ist. Weil er sofort auch die Legitimationsfrage stellt und impliziert, dass die Journalisten eigentlich nicht legitimiert seien, eine solche vierte Gewalt überhaupt zu bilden. Deshalb halte ich den Begriff für ein bisschen hochgestochen.
Also ins Parlament weniger Juristen und in den Journalismus mehr Kritiker. Haben Sie denn Vorschläge was man – auf die Journalisten bezogen – ändern könnte oder müsste?
Scholl: Zunächst stellt man ja fest, dass es in dieser Einstellung offensichtlich Generationsunterschiede gibt. Und man kann den Journalisten ja nicht beibringen, dass sie ein anderes berufliches Selbstverständnis bekommen. Zumal die berufliche Realität für sie immer schwerer wird. Kritische Berichterstattung ist eine, die aufwändig ist und die sich gleichzeitig nicht besonders gut auszahlt, wenn man es rein monetär sieht. Dementsprechend ist es erstmal kein Wunder, dass das aufgrund der äußeren Gegebenheiten weniger geworden ist. Trotzdem würde ich aber umgekehrt sagen, dass man jetzt nicht das Handtuch werfen muss, denn es gibt ja genug Initiativen, die genau dieses Defizit nicht nur vorhersehen, sondern auch kritisch begleiten. Zum Beispiel das netzwerk recherche, das zwar in erster Linie die Recherche auf seine Fahnen geschrieben hat, aber Recherche ist ja die Basis für kritischen Journalismus.
Dr. Armin Scholl ist Privatdozent am Institut für Kommunikationswissenschaft der Westfälischen Wilhelms Universität Münster

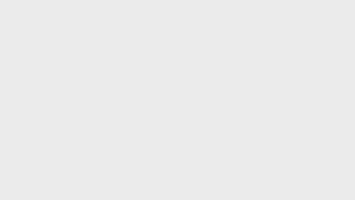
Kommentar hinterlassen